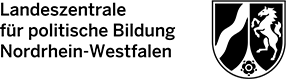Die Taschenuhr

Vom Polizeigefängnis zur Gedenkstätte: Mahn- und Denkstätte Steinwache Dortmund
1928 wurde direkt an der Nordseite des Dortmunder Hauptbahnhofes ein neues, großes und modernes Polizeigefängnis eröffnet. Die Modernität des neuen Gefängnisbaus war dezidierter Ausdruck des Reformwillens innerhalb der preußischen Polizei. Es war Teil eines größeren Gebäudekomplexes der Dortmunder Polizei, der aufgrund seiner Lage an der Steinstraße sowie der hier beheimateten Wache des 5. Polizeireviers vor allem als „Steinwache“ bekannt war.
Die Insassenschaft dieses neuen zentralen Haftortes der Dortmunder Polizeibehörde spiegelte stärker noch als die Gefängnisse der Justiz die gesellschaftlichen Vorstellungen von Kriminalität und politisch wie sozial abweichendem Verhalten sowie den Umgang mit deren Trägern. Dies blieb auch nach 1933 so, obwohl sich beides zum Teil drastisch änderte. So war es zunächst insbesondere die teilweise zur Hilfspolizei beförderte SA, die das Gefängnis als Haftort für politische Gegner*innen, aber auch Dortmunder Jud*innen nutzte und viele Menschen hier misshandelte. Nach dem Ende dieses „wilden Terrors“ der Anfangsphase übernahm die neugegründete Gestapo die Aufgabe der radikalen Verfolgung aller als Gegner*innen des neuen Staates Definierten. Die dabei auch im Polizeigefängnis ausgeübte brutale Gewalt sorgte für zahlreiche Opfer.
Für viele in „Schutzhaft“ genommene Gestapo-Häftlinge wurde die „Steinwache“ zur Durchgangsstation in die neu gegründeten Konzentrationslager. Gleichzeitig lieferte aber auch die Kriminalpolizei weiterhin ihre Gefangenen ein und begann ab Anfang 1934 damit, sogenannte Berufsverbrecher*innen in „Vorbeugungshaft“ zu nehmen und ebenfalls in Konzentrationslager zu deportieren. Aufgrund der Vorstellung, dass „das Verbrechertum im Asozialen seine Wurzelnhat und sich fortlaufend aus ihm ergänzt“, wurde im Zusammenhang mit der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung durch die Polizei die Verhängung von Vorbeugungshaft auch gegen Angehörige gesellschaftlicher Randgruppen, die sogenannten Asozialen, befohlen. Im Rahmen der darauf folgenden unter dem Namen „Aktion Arbeitsscheu Reich“ bekannt gewordenen Verhaftungsaktion wurden fast 300 Männer über die Steinwache in die KZ Buchenwald und Sachsenhausen deportiert.
Nach Kriegsbeginn gerieten mehr und mehr Menschen ins Visier der Polizei, die sich dem drakonischen Arbeitsregime der Kriegswirtschaft nicht fügen wollten oder konnten. Neben Polizeigefängnissen und Konzentrationslagern entstanden nun mit den Arbeitserziehungslagern neue regionale Haftstätten, in die die Gestapo Arbeitsvertragsbrüchige, „Arbeitsbummelant*innen“ und andere einwies – nachdem diese meist zunächst in der Steinwache inhaftiert gewesen waren, wobei auch im Polizeigefängnis selbst kurze Haftstrafen wegen Arbeitsversäumnissen verbüßt wurden.
Im Zusammenhang steigender Zahlen ausländischer Zwangsarbeiter*innen und den fortschreitenden Verwüstungen durch alliierte Luftangriffe ab 1943 stand die Steinwache inmitten einer mehr und mehr zerstörten Stadt und eines immer stärker improvisierten Systems von Haftorten. Fluchten insbesondere osteuropäischer Zwangsarbeiter*innen wurden zu einem Massenphänomen. Mit den sogenannten Auffanglagern und anderen „erweiterten Polizeigefängnissen“ entstanden ständig neue polizeiliche Haftorte, von denen die Steinwache nur noch einer war. Dennoch blieben auch hier vor allem sowjetische Zwangsarbeiter*innen die mit Abstand größte Häftlingsgruppe. Zwischen 1942 und 1945 stammte fast jeder zweite Insasse der „Steinwache“ aus der Sowjetunion. Eine Mischung aus Rassismus und Verfolgungseifer ließ die Gewalt gegen diese Häftlingsgruppe mit fortschreitender Kriegsdauer im Polizeigefängnis und vor allem in dessen Vernehmungsräumen immer mehr eskalieren. Auch Dolmetscher*innen und das Gefängnispersonal beteiligten sich an den Misshandlungen.
Gegenüber Polen und den sogenannten Ostarbeiter*innen gipfelte die polizeiliche Repression in Exekutionen durch die Gestapo. So sind Einzelfälle belegt, bei denen Betroffene direkt vom Polizeigefängnis zum Exekutionsort gebracht wurden, sei es in Dortmunder Parks, in Waldstücken oder – vor allem – in Konzentrationslagern. Die Zahl solcher Exekutionen stieg mit fortschreitender Kriegsdauer angesichts der eskalierenden Verhältnisse an der „Heimatfront“. Wiederum vor allem Osteuropäer*innen wurden vielfach des Widerstands oder der Vorbereitung von Aufständen verdächtigt und bei Vernehmungen so lange misshandelt, bis sie den Verdächtigungen entsprechend aussagten. Viele wurden schlichtweg als Plünderer oder aufgrund anderer Eigentumsdelikte exekutiert. Als in den letzten Kriegsmonaten durch die gesteigerten alliierten Bombenangriffe die lokalen Haftorte immer unsicherer wurden und der Abtransport in Konzentrationslager häufig nicht mehr möglich war, fing auch die Dortmunder Gestapo an, die Massenerschießungen osteuropäischer „Delinquenten“ vor Ort durchzuführen. So wurde die erste größere aus den Polizeigefängnissen rund um Dortmund stammende Gruppe „Ostarbeiter*innen“ Anfang Februar 1945 beim dienststelleneigenen Arbeitserziehungslager Hunswinkel im Sauerland exekutiert. Es folgten drei Massenerschießungen in der Bittermark, einem Wald im Süden von Dortmund, im März 1945. Ende März war das Ruhrgebiet schließlich durch alliierte Armeen im sogenannten Ruhrkessel eingeschlossen. Da eine Überstellung an Gerichte genauso wenig mehr möglich war wie eine Evakuierung von Häftlingen ging die Gestapo nun dazu über diejenigen, die sie „schwerer“ Delikte beschuldigte, zu erschießen, darunter auch deutsche Linke und Franzosen, die man der Spionage beschuldigte. Die meisten der später identifizierten Opfer hatte man allerdings aufgrund der sich immer mehr zuspitzenden Situation nicht mehr ins Polizeigefängnis gebracht, sondern direkt im ehemaligen Luftschutzkeller der Gestapo-Dienststelle im südlichen Stadtteil Hörde, in den dort vorhandenen Zellen oder in einem nahegelegenen ehemaligen Auffanglager inhaftiert. Von hier aus brachte man sie dann nachts zu nahegelegenen Bombentrichtern im Rombergpark und erschoss sie dort.
Trotz Bombenschäden wurde das Polizeigefängnis schließlich bis 1958 durchgehend betrieben. Auch wenn spezifisch nationalsozialistische Verfolgungsgründe wegfielen, hielt beispielsweise die klassische Kriegskriminalität noch weit über dessen Ende hinaus an. Auch im Umgang mit deviantem Verhalten insbesondere von (jungen) Frauen oder Homosexuellen gab es Kontinuitäten von Kriminalisierung. Mit der fortschreitenden gesellschaftlichen Stabilisierung sanken die Häftlingszahlen des Polizeigefängnisses immer mehr. Als Ende der 1950er Jahre im neuen Polizeipräsidium an der Hohen Straße auch ein – kleiner – Zellentrakt entstand, wurde das Gefängnis an der Steinstraße schließlich aufgegeben.
Bald darauf erwarb die Stadt das Haus und während das Hauptgebäude der Steinwache noch bis 1976 weiter als Polizeidienststelle fungierte, entstand nebenan eine vom Roten Kreuz betriebene Unterkunft für Nichtsesshafte. Nach deren Umzug war der komplette Gebäudekomplex in den 1980er Jahren zunächst vom Abriss bedroht. Nachdem sich der Rat der Stadt Dortmund für die Erhaltung entschieden hatte, wurde das Hauptgebäude nach Um- und Neubaumaßnahmen ab 1986 zum Domizil der Rheinisch-Westfälischen Auslandsgesellschaft. 1987 beschloss der Rat der Stadt Dortmund, die bereits existierende Ausstellung "Widerstand und Verfolgung in Dortmund 1933-1945" dauerhaft im Gefängnistrakt unterzubringen. Seit 1989 wurde eine dem Gebäude angepasste Ausstellungskonzeption entwickelt. Am 14. Oktober 1992 konnte schließlich die Mahn- und Gedenkstätte Steinwache eröffnet werden.
Diese ist seitdem der zentrale Ort lokaler und regionaler Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in Dortmund. In den letzten Jahren machten durchschnittlich jeweils etwa 21.000 Besucher*innen die Steinwache auch über die Stadtgrenzen Dortmunds hinaus zu einem wichtigen Träger historisch-politischer Bildung. Vor allem die zahllosen Führungen, Seminare und Projekttage trugen und tragen hierzu bei. Daneben ist sie durch regelmäßige Vortragsveranstaltungen und kleinere Wechselausstellungen aber auch Ort von Diskussion und Verständigung.
Derzeit wird an einer neuen Dauerausstellung gearbeitet, die das Haus selbst und dessen Geschichte in den Mittelpunkt stellt. In dieser wird auch das Schicksal der osteuropäischen Zwangsarbeiter*innen im Dortmunder Polizeigefängnis stärker beleuchtet und in die Entwicklung polizeilicher Verfolgung eingebettet. Und auch wenn der Besitzer oder die Besitzerin der in der Bittermark gefundenen Taschenuhr nicht mehr identifiziert werden kann, so wird diese doch wieder ihren Platz im ehemaligen Polizeigefängnis finden – dem Ort, der nicht nur für die Gruppe, zu der auch jeneR gehörte, die zentrale Schnittstelle zwischen (nationalsozialistischem) Alltag und der Welt der Lager, Gefängnisse und des Terrors war. Diese Verbindung von Alltag und Terror genauer zu beleuchten, soll dazu beitragen, das Funktionieren dieser Verhältnisse, die in die bekannten Menschheitsverbrechen mündeten, besser zu begreifen und damit letztlich auch einer in die Zukunft gerichteten Prävention Vorschub zu leisten.